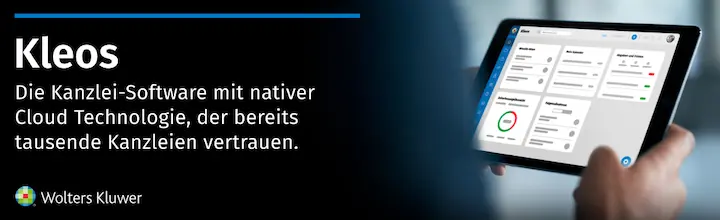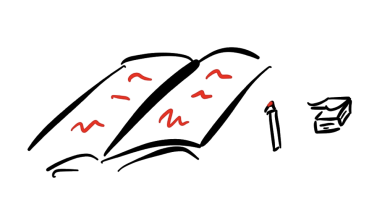Henning Müller: „Anwälte haben verständlicherweise meistens Angst vor etwas Neuem“

Henning Müller ist in einer noch immer ungewöhnlichen Domäne des Legal Tech unterwegs – dem Gericht. Als Sozialrichter und IT-Referent verantwortet er in der hessischen Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit die internen Digitalisierungsprozesse. Er betreibt unter www.ervjustiz.de einen Blog zum elektronischen Rechtsverkehr. Im Interview sprach Jolanda Rose(lawtechrose.com) mit ihm über neue Arbeitsmodelle im Richterdienst, den Einsatz von Legal-Tech-Software an Gerichten und Visionen für das Gericht der Zukunft.
Rose: Könnten Sie mir für die Leser ihren Job in zwei Sätzen zusammenfassen?
Müller: Ich bin Richter am Landessozialgericht und beschäftige mich in zweiter Instanz mit sozialgerichtlichen Berufungsverfahren. Außerdem bin ich als sog. Präsidialrichter in die Gerichtsverwaltung eingebunden. Hier bin ich für das IT-Referat und das Organisationsrefarat des hessischen Landessozialgerichts zuständig. Seit etwa einem Jahr bin ich im Wege der Abordnung an das hessische Landesarbeitsgericht dort ebenfalls als IT-Referent, also ausschließlich in der Gerichtsverwaltung, tätig.
Rose: Heißt das, dass Sie noch Fälle verhandeln oder sind Sie nur noch in der Verwaltung tätig?
Müller: Man muss als Richter auch immer ein richterliches Dezernat haben. Das ist bei mir natürlich ein relativ geringer Anteil. Auf dem Papier sind es 25 Prozent meiner Tätigkeit, d.h. bei einer Berufungsinstanz sind das circa 50 Verfahren. Diese Fälle verhandele ich selbstverständlich auch. Ich habe heute erst ein Eilverfahren durch Beschluss erledigt. Das ist also ganz normales Richtergeschäft nur mit einem etwas kleineren Dezernat.
Rose: Gerade als Richter ist man eher in der klassischen Juristerei unterwegs. Wie sind sie dann zu IT gekommen? War das eine persönliche Leidenschaft?
Müller: Ich bin ganz sicher nicht der klassische Nerd. Aber ich interessiere mich für Computer und dafür mit Computern effizient zu arbeiten.
Ich habe bei meinem Einstieg in die Justiz ein Programm vorgefunden, das sog. Justizfachverfahren. Das nennt sich EUREKA-Fach. Das ist ein Fachverfahren, das in praktisch allen deutschen Fachgerichten im Einsatz ist. Bei der Arbeit damit habe ich relativ schnell gemerkt, wie viel Potential in dem Programm steckt. Ich war fast entsetzt, dass meine Kollegen dieses Potential praktisch nicht nutzen. Darüber wollte ich mehr erfahren. Das war mein erster Schritt als Richter mich mit dem Computer weitergehender zu beschäftigen, als nur Word zu bedienen.
Nach einem Länderwechsel von Rheinland-Pfalz nach Hessen hatte ich, auf meine Anregung hin, die Aufgabe bekommen für die hessische Sozialgerichtsbarkeit den elektronischen Rechtsverkehr besser zu organisieren, als das in der Sozialgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz der Fall war. Das war tatsächlich auch ein bisschen holprig damals in Rheinland-Pfalz, weil die Ausführung der Aufgaben im elektronischen Rechtsverkehr sehr auf den Richter fokussiert waren und damit viele Funktionen der Arbeitsteilung, die EUREKA-Fach bietet, gar nicht nutzte. Dadurch entstand am Richterarbeitsplatz ein erheblicher Mehraufwand.
Rose: Das sollte ja eigentlich andersrum sein, oder?
Müller: Genau. Wir nannten die Akten, die mit dem elektronischen Rechtsverkehr geführt wurden, liebevoll die „elektrischen Akten“. Man muss sich mal die Skurrilität dessen vorstellen: Man bekam eine Papierakte in seinen Postzutrag, auf die ein @-Zeichen gemalt war. So wusste man, dass es eine Akte im elektronischen Rechtsverkehr war. Letztendlich wurde die dann erstmal in die Ecke geworfen, weil man wusste, dass die Bearbeitung dieser Akten länger dauert. Das wollte ich besser machen. Nachdem ich mit dem Entwickler von EUREKA-Fach in Kontakt gekommen bin, stellte sich zum Glück heraus, dass dieses Justizfachverfahren eigentlich viel besser und effizienter genutzt werden konnte, wir nur den Funktionsumfang gar nicht richtig genutzt hatten. Letztlich haben wir zwar mit Computern gearbeitet, aber in einer Organisation und mit einer Denkweise aus dem 19. Jahrhundert. Dies zu ändern war weniger eine technische Aufgabe, sondern eher im Zusammenspiel mit dem Programmierer des Fachverfahrens zu lernen, an welcher Stelle man für die Richterinnen und Richter, aber auch für die Serviceeinheiten, die Effizienzressourcen ausschöpfen kann. Also habe ich analysiert, wo wir Arbeitsschritte beschleunigen, vereinfachen und besser machen können.
Rose: Das ist ja eine außergewöhnliche Aufgabe als Richter. Wie war denn die Resonanz auf das Fachverfahren?
Müller: Technisch hat das Verfahren hervorragend und völlig problemlos funktioniert. Problematisch war jedoch, dass Hessen zwar den elektronischen Rechtsverkehr eröffnet hatte, uns aber keiner geschrieben hat. Innerhalb von vier Jahren seit Eröffnung des elektronischen Rechtsverkehrs hat uns fast niemand etwas geschickt und wir haben auch nichts zurückgeschickt. Wir hatten praktisch nur ein elektronisches Postfach eröffnet und waren bereit alles, was dort hinein kam auszudrucken. Mir war klar, dass ich für den nächsten Schritt aktiv auf Partner zugehen musste. Wir haben dann zwei Partner gefunden. Auf der Passivseite die hessische Versorgungsverwaltung, die sich insbesondere mit dem Grad der Behinderung beschäftigt. Das sind Fälle, die juristisch nicht gerade hochkomplex sind, aber medizinisch teils anspruchsvolle Sachverhalte. Deshalb werden in solchen Verfahren über Gutachten, ärztliche Befunde, usw. sehr viele Schriftsätze getauscht. Auch der VdK, ein Sozialverband, der die Kläger u.a. in solchen Verfahren vertritt, war bereit, am elektronischen Rechtsverkehr teilzunehmen. Dadurch hatten wir 2012 den Stand erreicht, dass wir in diesen Verfahren sowohl auf Kläger- als auch auf Beklagtenseite Beteiligte hatten, die den elektronischen Rechtsverkehr nutzten. Deshalb hatten wir erstmalig die Situation, dass wir vollumfänglich, auf dem Hin- und auf dem Rückweg, elektronische Dokumente übermitteln konnten – von der Klageschrift bis zum Urteil.
Rose: Das klingt wahnsinnig kompliziert. Ich wusste gar nicht, dass man dafür so viel werben muss. Also hat keiner darauf gewartet oder sich darauf gefreut?
Müller: Nein gar nicht, kein bisschen. Es gab praktisch keinen, der daran teilnehmen wollte. Es gab einzelne Anwälte, die das gemacht haben. Aber das waren wirklich ganz, ganz wenige.
Rose: Mit welcher Begründung? War es technisch noch zu schlecht aufbereitet? Oder war die User Experience zu schlecht, d.h. musste man sich erst drei Jahre in das System einarbeiten, um es zu verstehen?
Müller: Das glaube ich tatsächlich nicht. Technische Grundlage war damals wie heute EGVP, das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach, das gab es seit 2001, wurde stetig weiterentwickelt und war in viele Anwaltsfachanwendungen integriert. Ich glaube einfach, Anwälte haben das nicht gemacht, weil das was Neues war: Anwälte haben verständlicherweise meistens Angst vor etwas Neuem, weil sie Haftung fürchten. Man muss auch dazu sagen, es gab schlicht keinen Grund für einen Anwalt, einseitig elektronische Dokumente ans Gericht zu schicken und dann einen Brief oder ein Fax zurück zu bekommen. Eine solche elektronische Einbahnstraße kostet Akzeptanz: Der Anwalt selbst hat dann ja nicht wirklich etwas davon. Behörden haben schlicht deshalb nicht daran teilgenommen, weil das Aufwand ist. Behörden sind immer personell und finanziell knapp aufgestellt. Wenn es da keinen Zwang gibt das zu tun, machen sie es nicht.
Rose: Sie haben zwei Jahre lang als Vertreter der Justiz mit dem ersten komplett elektronischen Verfahren auf der Cebit ausgestellt. Haben Sie dort eine Art Lobbyarbeit für den Einstieg in die Digitalisierung gemacht?
Müller: Genau. Das Verfahren war aufgrund unseres Justizfachverfahrens technisch einfach – es gab praktisch keine technischen Probleme. Man musste einfach nur Leute auf Kläger- und auf Beklagtenseite finden, die bereit sind das zu machen. Ich war sehr dankbar vom Gerichtspräsidenten in dem Bereich freie Hand bekommen zu haben. Das ist schon etwas Seltenes in der Justiz.
Rose: Was hat sich seitdem noch getan? Wenn Sie jetzt sagen, es kann nur zu Ihnen elektronisch übermittelt werden, gab es dann in der Zwischenzeit jetzt schon Fälle, wo es komplett elektronisch lief?
Müller: Ab 2012 haben wir auch den elektronischen Postausgang eröffnet. Wir hatten Signaturkarten, mit denen wir qualifizierte elektronische Signaturen anbringen konnten, sodass wir unsere Urteile signieren und elektronisch zustellen konnten. Bis auf die Partner, die wir angesprochen haben, hatten wir allerdings immer noch keine Beteiligten, die mit uns kommuniziert haben.
Rose: Also auch nachdem das beidseitig möglich war, konnten Sie dafür wenig Leute gewinnen?
Müller: Richtig. Da hatten wir immer noch wenige und jetzt kam eine parallele Entwicklung mit dem sogenannten E-Justice-Gesetz; ein echter „Game Changer“: Bisher war ja der elektronische Rechtsverkehr eröffnet und Anwälte konnten schicken, oder sie konnten es halt lassen. Das innovative am E-Justice-Gesetz war der strikte Zeitplan, bei dem Beteiligte am Rechtsverkehr plötzlich gezwungen waren den elektronischen Rechtsverkehr zu nutzen. Das E-Justice-Gesetz hat den offiziellen Titel “Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs”. Das ist eigentlich Etikettenschwindel: Das Gesetz müsste eigentlich heißen “Das Gesetz zur zwangsweisen Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs”. Das hat ganz viel geändert, denn jetzt waren die Anwälte, aber auch die Behörden, die bisher ja so träge waren, plötzlich unter Zugzwang. Die Anwälte mit einem ganz straffen Zeitplan. Die mussten bis zum 01.01.2016 das besondere, elektronische Anwaltspostfach einrichten. Dann ab dem 01.01.2018 passiv erreichbar sein über das beA und ab dem 01.01.2022 – und das ist ja, wenn man diese Zeiträume sieht, über die wir da reden, quasi übermorgen – müssen sie den elektronischen Rechtsverkehr aktiv nutzen, wenn sie vor Gericht die Schriftform wahren wollen. In den Jahren danach kam so eine unglaubliche Dynamik in die Sache. Aktuell sind wir mittendrin in der Entwicklung und das macht diese Zeit jetzt ganz spannend. Noch nicht alle deutschen Gerichte können das, was wir in der hessischen Sozial- und Arbeitsgerichtbarkeit schon können. Seit Anfang 2018 sind jedoch zumindest alle deutschen Gerichte elektronisch erreichbar und das nimmt für Anwälte schonmal den ersten, ganz massiven Kritikpunkt: Jetzt bekommen die Anwälte, die zwangsweise ihr beA an die Haustür gehängt bekommen haben, auch Schreiben vom Gericht einfach ins beA – ob die Anwälte wollen oder nicht. Wir nennen das liebevoll den initiativen elektronischen Rechtsverkehr. Wir warten nicht, bis uns jemand was elektronisch schickt, sondern wir schicken das elektronisch raus. Anwälte sind dem elektronischem Rechtsverkehr jetzt zwangsweise ausgesetzt und bei vielen macht es „Klick“. Wir haben nun wöchentlich neue Kanzleien, die das Angebot nutzen auch an uns zu schicken.
Rose: Das ist ja schon anstrengend diese Langatmigkeit nur zu hören. Das muss ja auch für Sie persönlich anstrengend gewesen sein.
Müller: Ja, es hat zehn Jahre gedauert. Es war wahnsinnig langwierig, teilweise auch langweilig und frustrierend, weil zwischendurch auch mal lange nichts passiert ist. Jetzt kommt das aber sehr plötzlich. Diese Plötzlichkeit hat natürlich auch das ein oder andere an Herausforderungen.
Rose: Das ist ja schon eine große Veränderung. Haben Sie da jetzt schon Feedback von den Anwaltskanzleien bekommen, dass sich das für sie lohnt – also außerhalb davon, dass Sie jetzt dazu gezwungen sind? Hat das für die Anwälte auch einen Nutzen?
Müller: Da muss man auch wieder sehr darauf abstellen, ob Anwälte dazu bereit sind, entweder nur die Technik zu verwenden, oder aber auch ihre Organisation auf die Technik umzustellen. Anwälte, die einfach nur das beA benutzen, um schlimmstenfalls eingescannte Schriftsätze ans Gericht zu schicken und andersherum Schreiben, die sie vom Gericht bekommen, ausdrucken, sind unglücklich damit. Denn sie sehen nur das, was jeder von uns kennt, wenn er einen Computer benutzt – da hakt mal was, oder es ist etwas falsch konfiguriert. Die sind im Wesentlichen frustriert. Anwälte, die aber bereit waren, ihre Kanzleiorganisation anzupassen und richtig etwas zu verändern, die merken plötzlich wie viele Vorteile das neue System hat. Beispielsweise bekommen sie texterkannte Schriftsätze vom Gericht, die sie nach Stichworten durchsuchen können. Außer kann man Strukturierungswerkzeuge anwenden oder Teile der Schreiben, die vom Gericht kommen, in eine sichere Cloud legen. Wenn man es gut macht und man sich damit beschäftigt, dann merkt man wie effizient und gut das ist. Die Anwaltschaft, aktuell gibt es rund 160.000 Anwälte, ist unglaublich unterschiedlich aufgestellt. Da sind Anwälte, die keinen Computer auf ihrem Schreibtisch, schlimmstenfalls nur ein Diktiergerät mit Magnettonband haben und alles andere macht das Sekretariat. Die werden nie mit dem beA zufrieden sein. Dagegen gibt es ganz innovativ aufgestellte Anwaltskanzleien, die ganz andere Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können und die komplette Digitalisierung des Anwaltsberufs mit allen Vorteilen umsetzen.
Rose: Sie hatten es vorhin schon angesprochen, was hat sich durch diesen plötzlichen Wandel für eine Dynamik ergeben?
Müller: Durch diese Plötzlichkeit, mit der der elektronische Rechtsverkehr Mainstream wurde, hat sich ganz viel in den Gerichten verändert. Da muss man jetzt ehrlich sein, die Gerichte haben sich bis jetzt verhalten, wie die von mir als schlecht aufgestellt beschriebenen Kanzleien. Wir haben Schriftsätze bekommen, ausgedruckt und haben sie in die Papierakte geheftet, die Papierakte dem Richter vorgelegt und der Richter hat schlimmstenfalls auf der Rückseite des ausgedruckten Schriftstücks mit Kugelschreiber verfügt. Das ist, würde ich mal behaupten und übertreibe nicht, bei mindestens 90 Prozent der Richterarbeitsplätze Gang und Gebe. Dann geht die Akte mit der handschriftlichen Verfügung zurück in die Serviceeinheit und die Serviceeinheit tippt das, was der Richter handschriftlich auf die Rückseite geschrieben hat, in den Computer ein.
Rose: Da denkt man sich von meiner Position, das kann nicht wahr sein.
Müller: So ist es. Der Prozess, der auf ganz vielen Richter-Schreibtischen heute stattfindet, ist unfassbar ineffizient. Meine Aufgabe hat sich deshalb gewandelt. Ich muss jetzt nicht mehr Werbung bei Prozessbeteiligten machen, doch endlich den elektronischen Rechtsverkehr zu eröffnen – das ist jetzt plötzlich ein Selbstläufer geworden – sondern meine Aufgabe richtet sich jetzt nach innen. Ich muss jetzt die Richterinnen und Richter überzeugen, den Kugelschreiber doch mal stecken zu lassen und im Computer zu verfügen. Ich muss sie überzeugen, dass das effizienter ist, dass das vielleicht sogar viel schneller geht. Das glauben mir viele Richter nicht und ich muss erst Live-Schulungen machen und mit den Richterinnen und Richtern alle Arbeitsschritte durchgehen, um Verständnis zu erzeugen. Das ist der erste Schritt und wenn meine Werbung gefruchtet hat, dann müssen Fortbildungen angeboten werden. Die Richterinnen und Richter müssen darin unterwiesen werden, wie sie Verfügungen für die Standard-Arbeitsschritte am Computer machen können und hierbei all die Komfortfunktionen eines modernen Fachverfahrens nutzen können. Das fällt einigen Kolleginnen und Kollegen richtig schwer.
Rose: Welche Möglichkeiten gibt es denn, die Richter zu motivieren sich mit digitalen Arbeitsabläufen anzufreunden?
Müller: Ich muss immer einen Mittelweg finden und überlegen, was kann ich gut „verkaufen“ und was nicht. Richter arbeiten seit Jahrzehnten schon mit sehr umfangreichen Textbausteinen. Das sind im Zweifel bis vor zehn Jahren immer Kopiervorlagen gewesen und dann wurde 30 Jahre lang die gleiche Kopiervorlage immer wieder kopiert. Irgendwann haben dann die Richterinnen und Richter angefangen, sich online Textbausteine anzulegen, vielleicht auch aus Juris oder beck-online kopiert. Gut angenommen wird dabei die teilweise Automatisierung der Textbausteine im Fachverfahren. Wir nennen das „Schreibwerk“. Das sind Textbausteine, die wir zentral zur Verfügung stellen. Unser Schreibwerk in der hessischen Sozialgerichtsbarkeit hat z.B. 5000 Textbausteine.
Rose: Das ist ja ordentlich.
Müller: Das ist schon eine riesige Datenbank. Natürlich nutzt kein Richter alle 5000 Textbausteine. Das schöne ist, dass der Richter, der das als effiziente Möglichkeit genutzt hat, diese Textbausteine im Fachverfahren anklickt und sie nicht mehr mit Kugelschreiber hinten aufs Papier schreibt. Der Vorteil ist, dass die Serviceeinheit nicht mehr abtippen muss, was er da geschrieben hat. So kann auch die Serviceeinheit viel schneller arbeiten. Also ist der ganze Prozess des Verfügens dadurch viel runder geworden. Daneben haben wir noch die individuellen Verfügungen zur Verfügung gestellt. Teilautomatisierte Verfügungen, die sich jeder Richter frei anpassen kann, bis hin zum Schreiben des Urteils.
Rose: Es gibt ja regelmäßig den Ruf nach verkürzten Verfahren. Gegenargument ist da oft eine nur oberflächliche Würdigung gewisser Sachverhalte, die dem Kläger nicht mehr gerecht wird. Wie sehen sie das? Denken Sie es reicht den bestehenden Prozess zu digitalisieren, oder sollte man, vielleicht auch gesetzlich, den Prozess neu gestalten – über das beA hinaus?
Müller: Ich befürchte wir werden so schnell nicht erreichen, dass Verfahren in der Justiz auf Grund der Digitalisierung schneller gehen. Die Nadelöhre, um Verfahren zu erledigen, sind doch an anderer Stelle. Da brauchen wir den Richter, der entscheidet und hier ist das Nadelöhr ganz oft die mündliche Verhandlung und die Zeit eine mündliche Verhandlung zu haben. Um Verfahren schneller zu erledigen, brauchen wir schlicht eins, und zwar mehr Personal. Die Politik und Justizminister stellen noch, wenn es zusätzliche Verfahrensschlagzeilen gibt, das war jetzt z.B. 2015 in der Verwaltungsgerichtsbarkeit der Fall, relativ schnell neue Richter ein. Über dieses Stöckchen kann ein Justizminister einigermaßen gut springen, weil das halt auch in der Öffentlichkeit als Pressemitteilung gut zu verkaufen ist. Was aber ganz oft passiert, ist, dass nicht ausreichend zusätzliches nichtrichterliches Personal eingestellt wird. So werden in den Serviceeinheiten durch zusätzliche Richter noch größere Lücken gerissen. An dieser Stelle hilft die Digitalisierung. Denn in den Serviceeinheiten kann man natürlich sehr viel effizienter mit einem Richter arbeiten, der seine Verfügungen elektronisch macht, der vielleicht sein Urteil komplett fertig hinterlegt und die Serviceeinheit muss es nur noch absenden. Ich fürchte das macht das Verfahren nicht viel schneller, aber jedenfalls den Arbeitsdruck im nichtrichterlichen Dienst erträglicher, denn das ist er manchmal nicht mehr. In manchen Gerichten ist im nichtrichterlichen Bereich wirklich die Hölle los.
Im zweiten Teil des Interviews geht es um die Rolle der Digitalisierung in der Juristenausbildung und das Berufsbild des modernen Richters. Dieser wurde hier bei LAWTECHROSE veröffentlicht.
Das Interview führte Jolanda Rose. Sie ist Legal Tech Bloggerin bei lawtechrose.com und Jurastudentin an der FU Berlin. Außerdem arbeitet sie im Content und Social Media Marketing bei der Gesellschaft für die Digitalisierung der Rechtsdienstleistungen.